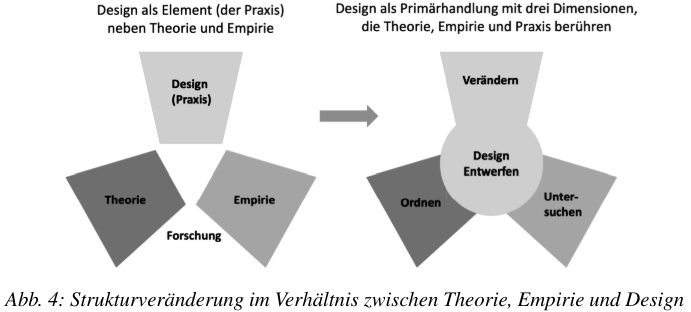In meinem letztens Blogbeitrag hatte ich die „Prä-empathische Zusammenarbeit“ von Jöran Muuß-Mehrholz etwas einsilbig aufgegriffen, was dem Züricher Gesamteindrücken geschuldet war. Nun also nochmal etwas ausführlicher.
In einem aktuellen Blogbeitrag beleuchtet Jöran unterschiedliche Aspekte der „Zusammenarbeit“. Dabei geht es ihm darum, nach den großen Superlativen (McKinsey sagt’s) und kleinen Anleitungen (Hacks & Tipps) ein „Mittelfeld mit Substanz“ zu bestimmen, was aus einer sozialen Perspektive viel mit Vereinheitlichung, Absprachen und Standards zu tun hat und technisch mit Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität bestimmt werden kann. Oder einfacher: Weil die Daten in der Cloud liegen und von allen jederzeit von überall eingesehen und verändert werden können, darum braucht es eine gemeinsame Strategie, damit Zusammenarbeit gelingt. Er nennt das das „Handwerk des Teilens“, was vom Sound – gewollt oder ungewollt –nah an Peter Bieris „Handwerk der Freiheit“ liegt, also an einer reflexiven Handlungspraxis, die den Kopf im Himmel der Ideale und die Füße auf der Erde des Notwendigen hat. Wo soll also dieses Handwerk herkommen?
Eines ist sicher, ein Handwerk fällt nicht vom Himmel, es wird vielmehr gemacht. So wie Schule heute organisiert ist, lernen SchülerInnen nicht das Handwerk des Teilens, sondern das Handwerk der „Alleinarbeiten“ (Jöran): Allein arbeite man dann, wenn man Kontrolle behalten will, Kontrolle über Lernziele- und -inhalte, über methodische Formen der Prozess- und Prüfungsgestaltung sowie Kontrolle über die Illusion, was am Ende gelernt wurde, so könnte man sagen.
Was wäre also zu tun, um solche Kontrollüberzeugungen zu ändern? Man kann innovative Projekte an Schulen starten (Trojanisches Pferd, Katalysator), man kann die Fortbildung von LehrerInnen z.B. mit neuen Methoden und dem Begründungswissen von Jöran anreichern. Aber reicht das? Jöran betont in einem eigenen Blogbeitrag, dass „Schule unglaublich stabil ist“, viele Dinge sich also nicht oder unzureichend ändern; es hat den Anschein, als wolle sich „das System“ nicht in Richtung eines neuen Zustands hin verändern.
Ich habe drei Thesen, die man diskutieren könnte.
Zum ersten bin ich der festen Überzeugung, dass man Systeme, wie die Schule, nur dann ändern kann, wenn man AUCH den Ort berücksichtigt, wo sich das System selbst reproduziert, und das ist zumindest zum Teil die Referendariatsausbildung. Dort, in der zweiten Ausbildungsphase, werden angehende LehrerInnen auf Ihre Arbeitspraxis hin „geprägt“, nachhaltig geprägt, was manchmal nah an einer lebenslangen Schädigung liegt. Hier gilt es also, die AusbilderInnen (und die Leitungen) davon zu überzeugen, dass digitale Zusammenarbeit keine modische Methodenübung ist, sondern eine auch lustvolle Abgabe von Kontrolle zugunsten eines didaktischen Mehrwertes sein kann, der gerade durch den Kontrollverlust entsteht. Und das darf man nicht blutleer erklären oder gar „vermitteln“, sondern das muss in experimenteller Praxis erprobt, erfahren und langfristig eingeübt werden, denn: Man muss das Driften lernen, um eine neue und höherwertige Form der Kontrolle zu etablieren. Was mich zum zweiten Punkt bringt.
Ich glaube zum zweiten, dass das Mantra des Paradigmenwechsels (die großen Shifts), hier „gute“ Zusammenarbeit und dort „schlechte“ Alleinarbeit, Teil des Problems ist. Zwar ist es richtig, dass wir gerade für eine digitale Arbeitswelt fast völlig blank an methodischer Kompetenz sind, wie wir Zusammenarbeit organisieren, wir brauchen das also (Zusammenarbeit 4.0)! Aber: Wir sind auch völlig unzureichend vorbereitet auf intensive Formen der Alleinarbeit, die man ganz zweifellos in einer digitalen Arbeitswelt AUCH braucht; allein das akademische Studium besteht zu ca. 50% aus Alleinarbeit (dem Selbststudium, angeleitet und frei) und auch in der Arbeitswelt kann und sollte nicht alles in Form von Kooperation und Kollaboration stattfinden. Denn auch hier ist die tiefe Einzelarbeit sinnvoll, von Fall zu Fall, von Phase zu Phase, von Problem zu Problem. Wichtig ist also die „Wechselkompetenz“, wann welche Form der Arbeit funktional ist, das müssen wir lernen. Was mich zu einer dritten These führt.
Alle Formen der Arbeit und des Lernens sind gebunden an etwas sehr Schnödem (was man heute nicht mehr gerne hört): Disziplin! Ich kenne genügend Vorhaben oder Versprechen, in denen beim Start alle Feuer und Flamme sind, zusammenzuarbeiten, klar, was sonst?! Doch dann wartet man wieder Tage auf Rückmeldung oder die abgesprochenen Beiträge kommen erst weit nach der Deadline. Deadline, da stirbt im Übrigen keiner mehr, manchmal wachen die Leute erst auf. Disziplin kennt auch die Alleinarbeit, der innere Schweinehund ist eine gute Metapher für den inneren Gegenspieler, den man überwinden muss.
Man merkt an diesen Thesen: Von einer Vereinseitigung halte ich wenig, Allein- und Zusammenarbeit gehören zusammen (Arbeitsformen), genauso wie Disziplin und Kontrollverlust (Tugenden) oder Ausbildung- und Fortbildung (institutionelle Settings). Das macht das Ganze auf den ersten Blick nicht leichter, weil es nach „mehr und unentschieden“ klingt. Ich denke aber, dass ein guter Teil der Reformkrisen (in Bildungssystemen) auf die Kappe von unterkomplexen Lösungsformeln geht. Klar, wir müssen alle „irgendwo anfangen“ (verführerisch einfach und eindeutig, um einen Fuß in der Tür zu haben), aber ich vermute, dass eine nachhaltige Vorgehensweise eher drin liegt, auf Widersprüchliches und Mehrdeutiges vorzubereiten und das auch von Anfang an zum Thema zu machen! Widersprüchliches und Mehrdeutiges nicht nur auszuhalten, sondern (gemeinsam) daran auch noch Spaß zu haben, das ist keine Unmöglichkeit, sondern eine echte Future Skill.