 Nun ist sie vorbei, die Zukunft Personal 2012, Europas größte Personalmesse. Wir Ghostthinker (im Bild: Johannes, Hanna und ich) waren erstmals mit einem eigenen Stand vertreten, ganze 3×3 Meter standen uns für Präsentation und Kundenkontakt zur Verfügung. Die zentrale Frage im Vorfeld lautete: „Wie schaffen wir es, unser edubreak-Produkt angemessen zu kommunizieren?" Videoannotation, Videoreflexion, Videokollaboration sind ja keine Begriffe, die runter gehen wie Butter, Blended Learning 2 oder 3 oder 4.0 zu unspezifisch. Wir haben uns nach vielen (kreativen) Überlegungen auf WE STOP VIDEOS geeinigt (siehe Bild), haben diesen Ansatz mit einem Großbild vom edubreakPLAYER spezifiziert (unser Feuerwehrmann) und per Beamer konkrete Einsichten in den edubreakCAMPUS gegeben. Mit diesem kommunikativen „Dreischritt" sind wir gut zurechtgekommen, konnten viele Interessierte abholen und in ein Gespräch bringen.
Nun ist sie vorbei, die Zukunft Personal 2012, Europas größte Personalmesse. Wir Ghostthinker (im Bild: Johannes, Hanna und ich) waren erstmals mit einem eigenen Stand vertreten, ganze 3×3 Meter standen uns für Präsentation und Kundenkontakt zur Verfügung. Die zentrale Frage im Vorfeld lautete: „Wie schaffen wir es, unser edubreak-Produkt angemessen zu kommunizieren?" Videoannotation, Videoreflexion, Videokollaboration sind ja keine Begriffe, die runter gehen wie Butter, Blended Learning 2 oder 3 oder 4.0 zu unspezifisch. Wir haben uns nach vielen (kreativen) Überlegungen auf WE STOP VIDEOS geeinigt (siehe Bild), haben diesen Ansatz mit einem Großbild vom edubreakPLAYER spezifiziert (unser Feuerwehrmann) und per Beamer konkrete Einsichten in den edubreakCAMPUS gegeben. Mit diesem kommunikativen „Dreischritt" sind wir gut zurechtgekommen, konnten viele Interessierte abholen und in ein Gespräch bringen.
Für mich neu war der Messemodus: Neun Stunden Dauerakquise, also Gesprächsbereitschaft und tatsächliche Gespräche mit Menschen aus dem Trainingsumfeld (Innovation, Personal, Kommunikation, Persönlichkeit, Therapie, Rettung, Sicherheit). Erst im Gespräch ergaben sich die konkreteren Einsatzszenarien, die man mehr oder weniger aus dem Stegreif auf die edubreak-Potenziale anpassen musste. Das klappte überwiegend gut, denn die aktive Bearbeitung von Videos durch Kommentare im Rahmen von Blended Learning-Szenarien ist anschlussfähig und wir sehen, dass die Erfahrungen rund um die Sporttrainerausbildung seit 2007 viele Transferideen bieten.
Besonders interessant fand ich ein Brainstorming mit Kollegen (Briten die deutsch konnten :-) aus dem „Innovationstraining". Neben den allgemeinen Erfahrungen zum Blended Learning und zur Videokommentierung finde ich diesen Bereich wegen des Gegenstands hochspannend: Wie kann man Kreativität und unternehmerisches Denken fördern, wie kann man Menschen dazu animieren, Innovationen in ihren Organisationen voranzutreiben? Da kommen zurückliegende Erfahrungen aus meiner Siemenszeit und zum Analogietraining wieder hoch und verbinden sich mit den aktuellen Potenzialen der Videokommentierung – toll.
Apropos „Briten": Mit Peter Jones von Change Evolution hatte ich genau diese interessante Denkbewegung. In einem Mix aus Englisch und Deutsch hantierten wir etwas lauter zu Begriffen wie „Knowledge in Action", „Reflection in Action" und „Reflection on Action" – D. Schön lässt grüßen. Mit einem Ohr bekam ich mit, wie einer der Standbesucher fragte: „Ist dies ein deutsches Unternehmen?" Ghostthinker, We stop Videos, Denglish … ja wir waren sehr
international … für ganze drei Tage ;-).

 Der scheidende Vorsitzende der GMW – Prof. Ulf Ehlers – hat uns in seinem Tagungskommentar zur
Der scheidende Vorsitzende der GMW – Prof. Ulf Ehlers – hat uns in seinem Tagungskommentar zur 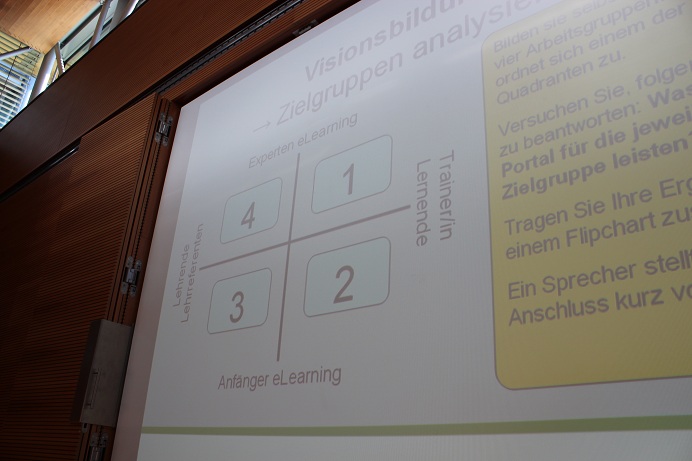 . September fand in Frankfurt in den Räumen des Deutschen Fußball Bundes e.V. die erste Tagung zum neuen bmbf-Projekt „
. September fand in Frankfurt in den Räumen des Deutschen Fußball Bundes e.V. die erste Tagung zum neuen bmbf-Projekt „ Am Wochenanfang waren Johannes und ich auf den Hamburger Medienkompetenztagen. Professor Andreas
Am Wochenanfang waren Johannes und ich auf den Hamburger Medienkompetenztagen. Professor Andreas  49,- Euro, ein Schnäppchen, dachte ich und zog die Turnschuhe an. Sie passten, perfekt. Der Verkäufer sagte, es sei ein Unpaar. Unpaar? Links größer als rechts, also fasch? Schuhe in unterschiedlichen Größen, das kommt gleich hinter Socken in zwei Farben (die ich schon länger trage).
49,- Euro, ein Schnäppchen, dachte ich und zog die Turnschuhe an. Sie passten, perfekt. Der Verkäufer sagte, es sei ein Unpaar. Unpaar? Links größer als rechts, also fasch? Schuhe in unterschiedlichen Größen, das kommt gleich hinter Socken in zwei Farben (die ich schon länger trage). Vor einigen Tagen war ich zusammen mit
Vor einigen Tagen war ich zusammen mit  Die Egoperspektive bei Videoaufnahmen interessiert mich schon länger, ich glaube da lässt sich noch Vieles rausholen, zumal wenn man die interaktiven Potenziale der Videoannotation hinzudenkt. Erste Versuche haben wir dazu 1999 gemacht, damals noch als konzeptionelle Idee zum Bewegungslernen im Sport mit dicken Brillen, 2009 im Rahmen des EU-Projekts zur Fahrlehrerausbildung, mit einer Spezialbrille von Daniel Düsentrieb aus München, welche die Blickrichtung der Pupillen scannt und zwei Kameras via Servomotoren in genau diese Richtung blicken lässt und 2010 im Rahmen einer kleinen BA-Studie, indem die Egoperspektive mit der Totalen hinsichtlich des Reflexionspotenzials in der Lehrerausbildung verglichen wurde. Folglich ist es für uns eine Pflichtübung, sich
Die Egoperspektive bei Videoaufnahmen interessiert mich schon länger, ich glaube da lässt sich noch Vieles rausholen, zumal wenn man die interaktiven Potenziale der Videoannotation hinzudenkt. Erste Versuche haben wir dazu 1999 gemacht, damals noch als konzeptionelle Idee zum Bewegungslernen im Sport mit dicken Brillen, 2009 im Rahmen des EU-Projekts zur Fahrlehrerausbildung, mit einer Spezialbrille von Daniel Düsentrieb aus München, welche die Blickrichtung der Pupillen scannt und zwei Kameras via Servomotoren in genau diese Richtung blicken lässt und 2010 im Rahmen einer kleinen BA-Studie, indem die Egoperspektive mit der Totalen hinsichtlich des Reflexionspotenzials in der Lehrerausbildung verglichen wurde. Folglich ist es für uns eine Pflichtübung, sich  Am Mittwoch bin ich auf Einladung von
Am Mittwoch bin ich auf Einladung von 
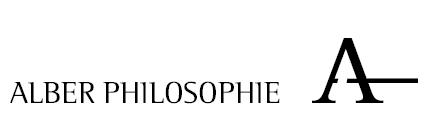 Vorletzte Woche war ich seit langer Zeit mal wieder in einer Vorlesung. Professor
Vorletzte Woche war ich seit langer Zeit mal wieder in einer Vorlesung. Professor