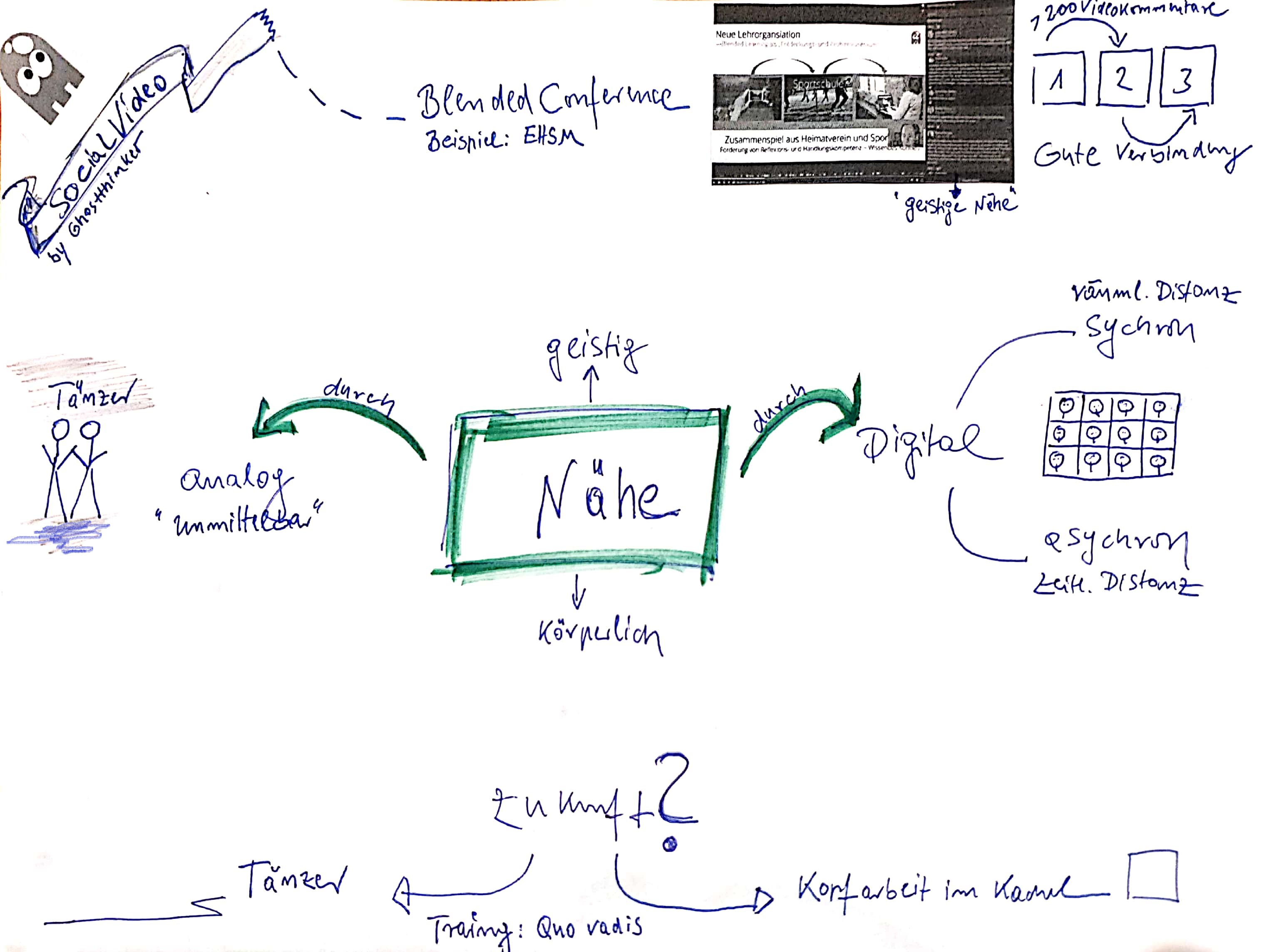Es waren die Anfänge bei Ghostthinker, als wir das Thema Social Video in viele Richtungen ausprobierten und explorierten: Ein Weg führte uns zu den Kindern, in die Grundschule. Den Anstoß dazu gaben damals Richard Heinen und Uwe Rotter (beide damals bei „Lehrer Online“, Richard jetzt bei der Montags Stiftung Jugend und Gesellschaft und Uwe beim Haus der kleinen Forscher), die offenbar noch so viel Kind in sich hatten, dass sie nicht nur die Idee von TechPi & MaliBu gut fanden, sondern auch das nötige Kleingeld für die ersten Serien besorgten – den „Kindsköpfen“ sei Dank!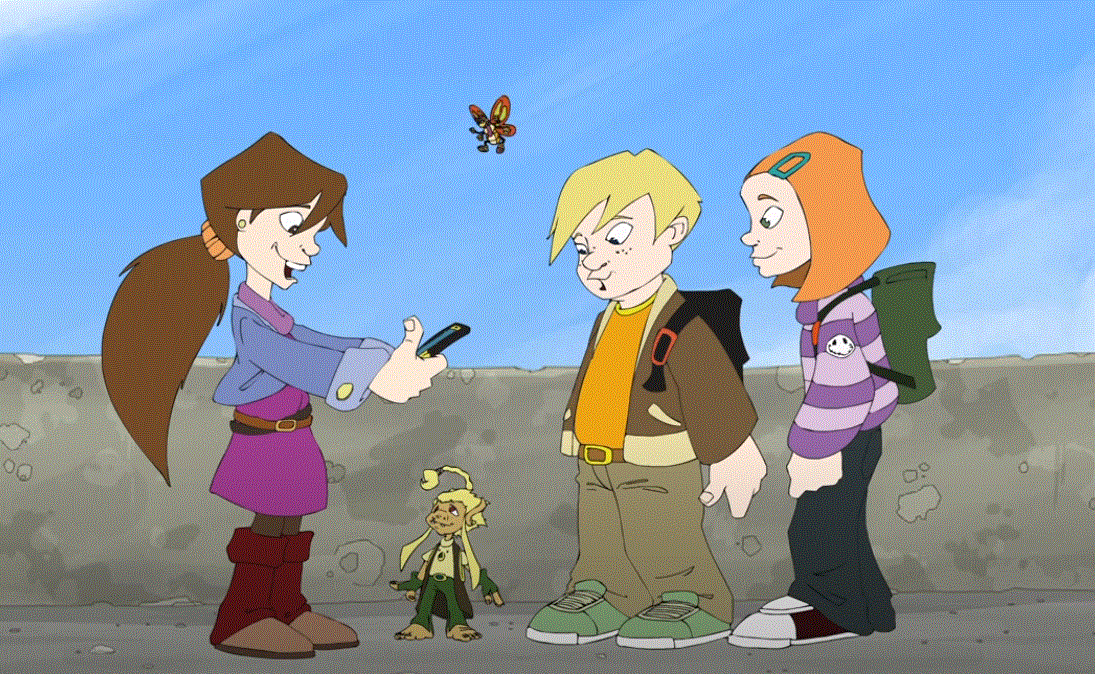
TechPi & MaliBu? Für alle, die die beiden noch nicht kennen: TechPi ist ein Außerirdischer vom Planeten Omitron mit kreativer Vorliebe für alles Technische; MaliBu ist sein irdischer Freud – ein Schmetterling – der die Sachen gerne mal zu Ende denkt – „tech meets social“ sozusagen. Zusammen erleben die beiden eine Reihe von Geschichten, die nicht nur für sie lehrreich sind, sondern immer wieder Kinder in den Bann ziehen: Klimaschutz, Umweltprobleme, Natur- und Artenschutz etc. und die Rolle des Menschen, also all das, was uns auch heute beschäftigt und was sich mit dem Begriff der „Dilemmata“ – sowas wie Zwickmühlen – auf den Punkt bringen lässt.
Unser Ziel war damals, über kurzweilige Kindergeschichten, diese Dilemmata zu skizzieren, um bei Kindern im Grundschulalter ein Interesse für diese Art von Problemen und zu wecken. Es ging um eine Denkhaltung, nicht mehr, aber auch nicht weniger!
Neben den aufwändigen Video-Geschichten (Inhalte) haben wir schon damals an mehr Beteiligung und Interaktion gedacht: Kinder konnten diese Videos im Klassenverbund mit Hilfe von Aufgabenblättern kommentieren, per Text und per Audio, was sie zum Weitererzählen der Geschichten animierte, also Social Video der besonderen Art. Wie toll das funktionierte, zeigte die Masterarbeit von Monika Gröller, die in einer Fallstudie herausfand, dass sich die Grundschulkinder tief in die Problemstellung eingraben und auch noch Wochen später, motiviert und informiert von den Geschichten und ersten „Lösungsversuchen“, berichten konnten (vgl. hier)
Aus aktuellem Anlass hat der Verein „Lebensraum Lechtal“ um Bereitstellung der Folge „Sackgasse am Fluss“ gebeten (der Verein war Sponsor!). Wir haben das nun in Absprache mit dem Verein auch auf YouTube gestellt.
Zwei Sachen sind mir wichtig:
- Man sieht was herauskommt, wenn „Kindsköpfe“ ihre Köpfe und Ressourcen zusammenbringen; zu den Kindsköpfen zählen mindestens auch Gabi Reinmann (mit der ich die Figuren entwickelt und Geschichten geschrieben habe), Johannes Metscher (technische Leitung des Projekts), Marco Rosenberg (Stimmen) und Frank Cmuchal – letzterer ist für die tollen Zeichnungen verantwortlich.
- Die Figuren sind aus meiner Sicht zeitlos „schön“ und der didaktische Rahmen (tech meets social) scheint mir heute mehr als zeitgemäß! Vielleicht findet sich ja ein Verlag, der das Ganze in einem professionellen Rahmen fortführen will. Der Anfang ist gemacht!