 Wir (Tamara, Silvia, Johannes, Stefan und ich) warem am Mittwoch und Donnerstag in Österreich, um in der Fahrwelt Kern unseren dritten und letzten EU-Workshop im Projekt "Driver Instructor Education 2.0" durchzuführen. Anders als bei den letzten Treffen haben wir diesesmal einen Eventtag vorgeschaltet. Auf dem Plan stand ein Sicherheitstraining, also Vollbremsung, Schleuderkurs und andere Dinge, die man sonst nicht macht, machen darf (im Foto eine Schleuderstrecke). Das hat viel Spaß gemacht und Einsichten erzeugt, die man vom Schreibtisch (auch bei intensivsten Nachdenken) nicht hin bekommt. Auf jeden Fall eine super Vorbereitung für den Folgetag, bei dem es wiedermal um das Thema "Videoreflexion in der Fahrlehrerausbildung" ging. Auf dem Workshop haben wir nach Darstellung von Projektverlauf und ersten wissenschaftlichen Ergebnissen über die Zukunft und die möglichen Weiterentwicklungen gesprochen. Hierbei gibt es vielfältige Perspektiven, angefangen von technologischen Weiterentwicklungen in Richtung tablet-PC, bis zu didaktischen und organsiationalen Innovationen. Innovationen? Das bei all dem nicht nur wir als Unternehmen (Ghostthinker), die Wissenschaft (UniBwM), die Praktiker der Ausbildungsinstitutionen am Tisch sitzt sondern auch der Vertreter des europäischen Berufsverbandes halte ich für besonders wichtig, wenn man in diesem Bereich nicht nur "Erfinden", sondern Erfindungen auch in die Breite tragen will. Gutes Tun und darüber reden: Tamara wird das in Kürze auf der red-conference (Schweiz) und dem fit to drive Kongress in Holland tun. Wir zeigen unser Produkt erstmals auf der Mitgliederversammlung des Bayerischen Fahrlehrer Verbandes Ende März.
Wir (Tamara, Silvia, Johannes, Stefan und ich) warem am Mittwoch und Donnerstag in Österreich, um in der Fahrwelt Kern unseren dritten und letzten EU-Workshop im Projekt "Driver Instructor Education 2.0" durchzuführen. Anders als bei den letzten Treffen haben wir diesesmal einen Eventtag vorgeschaltet. Auf dem Plan stand ein Sicherheitstraining, also Vollbremsung, Schleuderkurs und andere Dinge, die man sonst nicht macht, machen darf (im Foto eine Schleuderstrecke). Das hat viel Spaß gemacht und Einsichten erzeugt, die man vom Schreibtisch (auch bei intensivsten Nachdenken) nicht hin bekommt. Auf jeden Fall eine super Vorbereitung für den Folgetag, bei dem es wiedermal um das Thema "Videoreflexion in der Fahrlehrerausbildung" ging. Auf dem Workshop haben wir nach Darstellung von Projektverlauf und ersten wissenschaftlichen Ergebnissen über die Zukunft und die möglichen Weiterentwicklungen gesprochen. Hierbei gibt es vielfältige Perspektiven, angefangen von technologischen Weiterentwicklungen in Richtung tablet-PC, bis zu didaktischen und organsiationalen Innovationen. Innovationen? Das bei all dem nicht nur wir als Unternehmen (Ghostthinker), die Wissenschaft (UniBwM), die Praktiker der Ausbildungsinstitutionen am Tisch sitzt sondern auch der Vertreter des europäischen Berufsverbandes halte ich für besonders wichtig, wenn man in diesem Bereich nicht nur "Erfinden", sondern Erfindungen auch in die Breite tragen will. Gutes Tun und darüber reden: Tamara wird das in Kürze auf der red-conference (Schweiz) und dem fit to drive Kongress in Holland tun. Wir zeigen unser Produkt erstmals auf der Mitgliederversammlung des Bayerischen Fahrlehrer Verbandes Ende März.
Kategorie: Allgemein
Definition der Restklasse … großartig!
 Es gibt glaube ich ganz wenige HochschullehrerInnen, die ernsthaft mit ihrer Lehre (und damit mit sich selbst) experimentieren, also Neues schaffen. Christian Spannagel ist mit Sicherheit einer dieser Top 5! Bei dieser Behauptung geht es mir gar nicht so sehr um den Einsatz digitaler Medien, um Vorlesung "2.0" oder so etwas. Es geht mir vielmehr um die Haltung, mit der wissenschaftliche Lehre betrieben wird. Ich habe schon einige Beispiele gesehen: die Vorleser (aus ihrem eigenen Buch), die zerstreuten Freidenker (man kann schlecht folgen), die Folienbesprecher (ist oft langweilig) … keine Frage, Vorlesung "machen" ist schwer! Im Beispiel von Christian sieht man, dass Humor ein ganz wesentlicher Teil einer guten Vorlesung ist (sicherlich nicht der einzige). Mit Humor klappt auf jeden Fall das Geschäft mit der organisierten Wissensvermittlung leichter. Bravo!
Es gibt glaube ich ganz wenige HochschullehrerInnen, die ernsthaft mit ihrer Lehre (und damit mit sich selbst) experimentieren, also Neues schaffen. Christian Spannagel ist mit Sicherheit einer dieser Top 5! Bei dieser Behauptung geht es mir gar nicht so sehr um den Einsatz digitaler Medien, um Vorlesung "2.0" oder so etwas. Es geht mir vielmehr um die Haltung, mit der wissenschaftliche Lehre betrieben wird. Ich habe schon einige Beispiele gesehen: die Vorleser (aus ihrem eigenen Buch), die zerstreuten Freidenker (man kann schlecht folgen), die Folienbesprecher (ist oft langweilig) … keine Frage, Vorlesung "machen" ist schwer! Im Beispiel von Christian sieht man, dass Humor ein ganz wesentlicher Teil einer guten Vorlesung ist (sicherlich nicht der einzige). Mit Humor klappt auf jeden Fall das Geschäft mit der organisierten Wissensvermittlung leichter. Bravo!
Schöne Sache – eureleA 2011 geht an Ghostthinker
 Zusammen mit Stefan, Johannes und Ingo war ich am Dienstag auf der Learntec in Karlsruhe, um den „Pott“ abzuholen, wie wir im Vorfeld scherzhaft zu sagen pflegten. Zusammen mit anderen eureleA-Finalisten teilten wir uns eine kleine Ausstellungsfläche in unmittelbarerer Nähe des Bildungsforums, also recht zentral. Nach holpriger Anreise konnten wir unseren kleinen Strand just indem Moment beziehen, wo der Pressetross mit Ministerpräsident an uns vorbeizog (im Bild diese Situation).
Zusammen mit Stefan, Johannes und Ingo war ich am Dienstag auf der Learntec in Karlsruhe, um den „Pott“ abzuholen, wie wir im Vorfeld scherzhaft zu sagen pflegten. Zusammen mit anderen eureleA-Finalisten teilten wir uns eine kleine Ausstellungsfläche in unmittelbarerer Nähe des Bildungsforums, also recht zentral. Nach holpriger Anreise konnten wir unseren kleinen Strand just indem Moment beziehen, wo der Pressetross mit Ministerpräsident an uns vorbeizog (im Bild diese Situation).
klein.jpg) Nach vielen Gesprächen am Tage und der Präsentation des tollen L3T Projekts durch Sandra und Martin startete um 17 Uhr die Preisverleihung zum diesjährigen eureleA Wettbewerb. Vier Kategorien standen zur Wahl, wir – um es kurz zu machen – konnten in der Kategorie Projektwirkung die Jury überzeugen. Ehrlich gesagt: Ich habe nicht damit gerechnet. Einerseits, weil wir potente Mitbewerber hatten (VW, BASF, Polizei online etc.) und andererseits, weil wir ja nicht mit Content, sondern mit Prozessgestaltung punkten wollten, was schwer darstellbar ist. Doch die Jury hat offenbar genauer hingesehen. Neben der eigenen Freude im Team und an der UniBwM, freuen wir uns auch mit den Praxispartnern aus dem Tischtennis (DTTB, TTVN, WTTV), die uns in den Entwicklungsjahren seit 2007 die Stange gehalten haben. Hier gilt mein Lieblingssatz: „Es ist schwieriger aus nix einen Punkt zu machen, als aus einem Punkt einen bunten Ballon.“ Nun gut, … vielleicht hilft uns der eureleA-Preis nun dabei, den besagten bunten Ballon aufsteigen zu lassen. Die Zeit ist gut dafür.
Nach vielen Gesprächen am Tage und der Präsentation des tollen L3T Projekts durch Sandra und Martin startete um 17 Uhr die Preisverleihung zum diesjährigen eureleA Wettbewerb. Vier Kategorien standen zur Wahl, wir – um es kurz zu machen – konnten in der Kategorie Projektwirkung die Jury überzeugen. Ehrlich gesagt: Ich habe nicht damit gerechnet. Einerseits, weil wir potente Mitbewerber hatten (VW, BASF, Polizei online etc.) und andererseits, weil wir ja nicht mit Content, sondern mit Prozessgestaltung punkten wollten, was schwer darstellbar ist. Doch die Jury hat offenbar genauer hingesehen. Neben der eigenen Freude im Team und an der UniBwM, freuen wir uns auch mit den Praxispartnern aus dem Tischtennis (DTTB, TTVN, WTTV), die uns in den Entwicklungsjahren seit 2007 die Stange gehalten haben. Hier gilt mein Lieblingssatz: „Es ist schwieriger aus nix einen Punkt zu machen, als aus einem Punkt einen bunten Ballon.“ Nun gut, … vielleicht hilft uns der eureleA-Preis nun dabei, den besagten bunten Ballon aufsteigen zu lassen. Die Zeit ist gut dafür.
Innovationsfeld: Lehrerbildung (in Österreich)
 Gestern war ich im schönen Salzburg auf der Tagung „Forschung zur (Wirksamkeit der) LehrerInnenbildug" (links im Bild nicht die Universität, sondern ein Gebäude in der Stadt). Mit Reinhard Bauer als Co-Referent haben wir über die Potenziale des edubreak-Ansatzes für die (österreichische) Lehrerbildung gesprochen. DAS eine netzgestützte Videoreflexion (plus weiterer Werkzeuge wie Weblogs, E-Portfolio) gerade in der reformierten Lehrerbildung (Life Long Learning, Verzahnung von Theorie und Praxis, Kollegiale Beratung etc.) viel bewirken könnte, dies war und ist unsere Ausgangsthese (Zur „Wirksamkeit" vgl. Alexander Florian, Kapitel 4.2.).
Gestern war ich im schönen Salzburg auf der Tagung „Forschung zur (Wirksamkeit der) LehrerInnenbildug" (links im Bild nicht die Universität, sondern ein Gebäude in der Stadt). Mit Reinhard Bauer als Co-Referent haben wir über die Potenziale des edubreak-Ansatzes für die (österreichische) Lehrerbildung gesprochen. DAS eine netzgestützte Videoreflexion (plus weiterer Werkzeuge wie Weblogs, E-Portfolio) gerade in der reformierten Lehrerbildung (Life Long Learning, Verzahnung von Theorie und Praxis, Kollegiale Beratung etc.) viel bewirken könnte, dies war und ist unsere Ausgangsthese (Zur „Wirksamkeit" vgl. Alexander Florian, Kapitel 4.2.).
Da wir im Bereich der Lehrerbildung bisher „nur" Ideen, aber noch keine systematischen Erfahrungen (Studien) gesammelt haben, konnten wir auch nur ein analoges Konzept aus der Trainerbildung vorstellen. Was aber wie ein Hinkefuß klingt, empfinde ich als Diskussionsgrundlage für eine wissenschaftliche Tagung als Bereicherung, denn: Man kann sehen, wie ein „ganzheitliches Konzept" in einem anderen Bereich aufgebaut ist, um sich Anregungen für den eigene Bereich – hier der Lehrerbildung – zu holen. Was meine ich mit „ganzheitlich"? Im Sport haben wir das edubreak-Konzept von der Mikroebene der didaktischen Interaktion (Was tun die Studenten warum mit Text, Bild, Video konkret), über das Kursdesign auf der Mesoebene (Blended Learning-Formate) bis zur Vernetzung der Standorte zur Wissenskooperation auf der Markoebene ausbuchstabiert und dies heisst: die Aktivitäten der unteren Ebene sind Vorausssetzung für die übergeordneten Ebenen und die übergeordneten Ebene sind die Bedingungsstruktur für die untergeordenten Ebenen. Erst in dieser Gesamtstruktur wird die neue Qualität deutlich, interagieren die unterschiedlichen Ebenen (und Ressourcen) produktiv miteinander. Dieses „Muster" herauszuarbeiten und zu sehen, halte ich gerade dann für ganz wichtig, wenn es um qualitative Veränderungen in der Bildungspraxis (Innovationen) geht.
Apropos „Muster": Zuammen mit Reinhard habe ich dann den Restag dazu genutzt, fernab vom Tagungsstress in einer netten, sonnigen Bar über (didaktische) Muster zu sprechen. Dies ist sein Dissertationsthema und zusammen mit Peter Baumgartner arbeitet er am Thema. Die (sicherlich nicht
neue) Erkenntnis nach drei Stunden war, dass wir den Musterbegriff (in der Pädagogik) differenzieren müssen, um nicht Gefahr zu laufen, missverstanden zu werden (Muster ist fast alles). Einen Mehrwert erzeugt der Musterbegriff zumindest dort, wo sehr unterschiedliche didaktische Formate, Ressourcen, Zeit-Raumstrukturen mit unterschiedlichen Beschreibungen und Granularitäten kombiniert werden, dort also, wo bisher Begriffslosigkeit herrscht. …. Aber wie das in Gesprächen „dieser Art" so ist: das Muster lässt sich im Nachhinein nur sehr ungenau rekonstruieren. Und das ist gut so ;-).
Rollenmix oder besser: blended jobs
 Seit fünf Jahren bin ich nun Geschäftsführer der Ghostthinker GmbH, also Unternehmer, was mir großen Spaß macht, weil die Tätigkeit recht vielseitig und fordernd ist. „Nebenbei“ habe ich mich immer darum bemüht, den Faden zur Universität nie abreissen zu lassen (Veröffentlichungen, Freiwilligendienste in der Forschung und Lehraufträge an den Unis Augsburg und München), was bei einer wissens- und forschungsintensiven Unternehmung machbar ist.
Seit fünf Jahren bin ich nun Geschäftsführer der Ghostthinker GmbH, also Unternehmer, was mir großen Spaß macht, weil die Tätigkeit recht vielseitig und fordernd ist. „Nebenbei“ habe ich mich immer darum bemüht, den Faden zur Universität nie abreissen zu lassen (Veröffentlichungen, Freiwilligendienste in der Forschung und Lehraufträge an den Unis Augsburg und München), was bei einer wissens- und forschungsintensiven Unternehmung machbar ist.
Ab Januar 2011 habe ich mich nun neben meiner Geschäftsführertätigkeit auch für eine halbe Stelle an der UniBw München entschieden. Inhaltlich arbeite ich zusammen mit Gabi am Thema „Qualität und Evaluation von digitalen Selbstlernmedien“ (Kurze Projektbeschreibung). Auf diese „Wissen-schaftstage“ freue ich mich, zumal es ehe viele Querverbindungen zu anderen Forschungsprojekten und Personen gibt (Tamara, Marianne, Johannes), die alle an der UniBwM arbeiten. Ich hoffe, dass ich mein Engangement im genannten Forschungsprojekt gut einbringen kann.
Jahresrückblick 2010: Wer hätte das gedacht?
Ein vorweihnachtlicher, stiller Sonntag eignet sich gut dafür zu fragen: Wie war das Jahr 2010 für dich, was willst du in deinem Blog festhalten? Wirft man diese selbstgestellte Frage in den Raum taucht gleich eine neue Frage auf: Wie wähle ich aus, WAS ist mir wichtig, warum ist das so? Stellt man zu Beginn zu viele Fragen, dann legt man am Ende den Stift zur Seite uns sagt: „So wichtig war das alles nicht!“ … also frage ich nicht weiter und halte das fest, was in mir beim Schreiben aufsteigt.
Ein zentraler S tellenwert kommt sicher dem 2009 gestarteten EU-Projekt mit den Fahlehrern zu. Die anstrengende Antragsphase und die vielen Formalia zum Projektstart waren nervig, keine Frage. Aber die gesamte Praxisphase hat dann viel Spaß gemacht: angefangen beim KMH-Film in Wolfratshausen bis hin zur intensive Portalnutzung in den Ländern (D, A, B ,I): Wer hätte gedacht, dass die Ausbildungsstätten so relativ leichtfüßig Fahrvideos drehen, hochladen, die Anwärter Kommentare machen, wer hätte gedacht, dass die Österreicher spontan ein Weiterbildungskonzept entwickeln und umsetzen, wer hätte gedacht, dass die Deutschen nicht nur die Praxisstunden im Auto, sondern wie selbstverständlich auch den Theorieunterricht in das Projekt einbinden; wer hätte schließlich gedacht, dass unser 70-jährige Belgier das Gesamtkonzept super managt (ok, im Hintergrund wirkte seine Frau ordentlich mit). Wer hätte gedacht, dass wir gar ein neues Land zum Mitmachen gewinnen? Seit dem Spätsommer sind die Italiener dabei. Wer hätte gedacht, dass der anfänglich zwar offene, aber dennoch skeptische EFA-Präsident das Thema der onlinegestützten Videoreflexion nach dem zweiten EU-Workshop optimistisch mit den Worten einstuft: „Da stecken ungeahnte Potenziale drin“. Ja, und wer hätte gedacht, dass Tamara Ranner mit dem EU-Projekt zu ihrem Dissertationsthema findet, ihrem Thema! Und wer hätte gedacht, dass aus dem EU-Projekt heraus ein BMBF-Antrag erwächst, der das Potenzial von Web 2.0 in diesem exotischen Kontext weiterentwickeln will. Ich hoffe inständig, dass wir den großen Schwung, den wir in den knapp 15 Monaten erzeugen konnten, in einer geeigneten institutionellen Architektur auch im europäischen Rahmen fortsetzen können – Gespräche laufen.
tellenwert kommt sicher dem 2009 gestarteten EU-Projekt mit den Fahlehrern zu. Die anstrengende Antragsphase und die vielen Formalia zum Projektstart waren nervig, keine Frage. Aber die gesamte Praxisphase hat dann viel Spaß gemacht: angefangen beim KMH-Film in Wolfratshausen bis hin zur intensive Portalnutzung in den Ländern (D, A, B ,I): Wer hätte gedacht, dass die Ausbildungsstätten so relativ leichtfüßig Fahrvideos drehen, hochladen, die Anwärter Kommentare machen, wer hätte gedacht, dass die Österreicher spontan ein Weiterbildungskonzept entwickeln und umsetzen, wer hätte gedacht, dass die Deutschen nicht nur die Praxisstunden im Auto, sondern wie selbstverständlich auch den Theorieunterricht in das Projekt einbinden; wer hätte schließlich gedacht, dass unser 70-jährige Belgier das Gesamtkonzept super managt (ok, im Hintergrund wirkte seine Frau ordentlich mit). Wer hätte gedacht, dass wir gar ein neues Land zum Mitmachen gewinnen? Seit dem Spätsommer sind die Italiener dabei. Wer hätte gedacht, dass der anfänglich zwar offene, aber dennoch skeptische EFA-Präsident das Thema der onlinegestützten Videoreflexion nach dem zweiten EU-Workshop optimistisch mit den Worten einstuft: „Da stecken ungeahnte Potenziale drin“. Ja, und wer hätte gedacht, dass Tamara Ranner mit dem EU-Projekt zu ihrem Dissertationsthema findet, ihrem Thema! Und wer hätte gedacht, dass aus dem EU-Projekt heraus ein BMBF-Antrag erwächst, der das Potenzial von Web 2.0 in diesem exotischen Kontext weiterentwickeln will. Ich hoffe inständig, dass wir den großen Schwung, den wir in den knapp 15 Monaten erzeugen konnten, in einer geeigneten institutionellen Architektur auch im europäischen Rahmen fortsetzen können – Gespräche laufen.
Ja, das schon seit drei Jahren laufende Sportprojekt (Traineraus- und Weiterbildung) geht hinsichtlich seiner Entwicklung- und Implementation langsam dem Ende entgegen, d.h. wir haben in zwei Ländern „Alltagsbetrieb“, neue Bundesländer wollen nachziehen. Für Februar 2011 steht noch aus, die länderbezogenen Aktivitäten in eine bundesweite Community einzuführen, also das Bedürfnis nach länderübergreifendem Wissens- und Erfahrungsaustausch auch medientechnisch zu unterstützen. Auf der Grundlage dieses Modells (Didaktik, Technologie, Organisation) stehen wir im Austausch mit neuen Sportarten und Verbänden, so der Deutschen Handball Trainer Vereinigung (DHTV) und dem Deutschen Behinderten-Sportverband (DBS). Hier geht es darum, im neuen Jahr Einführungsarbeit zu leisten, d.h. vor allem die Lehrreferenten von den Vorteilen des mediengestützten Lehrens und Lernens zu überzeugen, Zweifel zu  zerstreuen und Chancen sichtbar zu machen. Ein neuer Kreislauf beginnt … Belohnt wurde diese vierjährige Aufbauphase nun mit der Nominierung zum eureleA-Preis 2011 (wir sind unter den 12 Finalisten, Juchuuu!).
zerstreuen und Chancen sichtbar zu machen. Ein neuer Kreislauf beginnt … Belohnt wurde diese vierjährige Aufbauphase nun mit der Nominierung zum eureleA-Preis 2011 (wir sind unter den 12 Finalisten, Juchuuu!).
In diesem Zusammenhang sind auch die neuen Projektkontext interessant: Dazu zählt zunächst die Musikausbildung, der sich Marianne Kamper in ihrer Doktorarbeit zuwenden möchte. Ich bin sehr gespannt darauf, welche neuen Anforderungen der Musikkontext (wenig Bewegung, viel Ton) stellen wird. Neu ist auch der Kontext Rettungsdienst und die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz, deren Projekt zum Pflegemanagement wir seit 2010 begleiten.
Interessant f ande ich gegen Jahresende den Besuch auf der online educa. Dort waren wir auf der Security-Fachtagung mit einem Vortrag (edubreakSECURITY) vertreten. Ich war am Vorabend angreist und konnte mich erstmals mit Sicherheitsfachleuten über aktuelle Herausforderungen unterhalten. Am Workshoptag selber konnten Johannes Metscher und ich die ganze Bandbreite des Sicherheitsthemas anhören, keine Militärs, aber viel Polizei (z.B. Olympische Spiele in London 2012) und andere Sicherheitsdienste. Jojo hat dann das Referat übernommen, was er – wie ich finde – sehr gut gemacht hat … für DIE Vorbereitungszeit ;-).
ande ich gegen Jahresende den Besuch auf der online educa. Dort waren wir auf der Security-Fachtagung mit einem Vortrag (edubreakSECURITY) vertreten. Ich war am Vorabend angreist und konnte mich erstmals mit Sicherheitsfachleuten über aktuelle Herausforderungen unterhalten. Am Workshoptag selber konnten Johannes Metscher und ich die ganze Bandbreite des Sicherheitsthemas anhören, keine Militärs, aber viel Polizei (z.B. Olympische Spiele in London 2012) und andere Sicherheitsdienste. Jojo hat dann das Referat übernommen, was er – wie ich finde – sehr gut gemacht hat … für DIE Vorbereitungszeit ;-).
Es ist unschwer 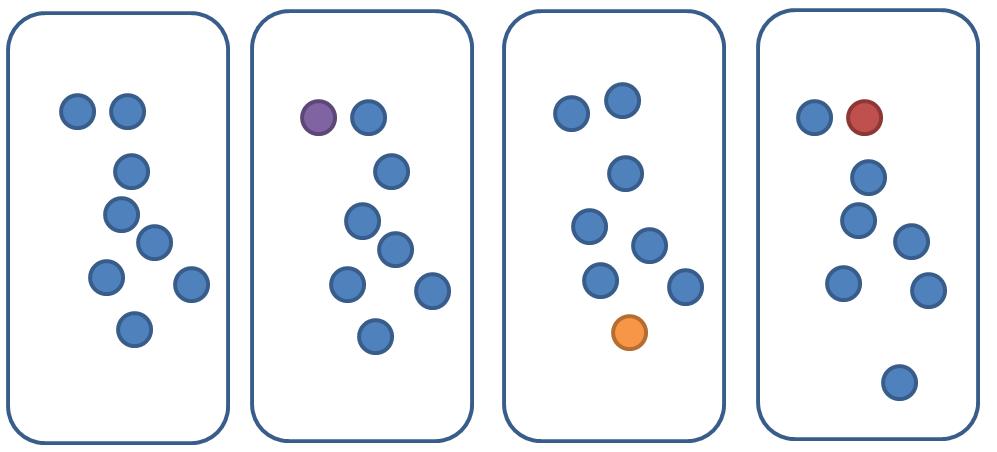 zu erkennen, dass mein aktuelles Leben sehr von einer Sache geprägt, ach was rede ich, getrieben ist: edubreak. 2007 war das nur ein Name, heute sind es viele Projekte, die sich weiter ausdifferenzieren. Hier und da hatte ich es schon mal angekündigt: Mich interessiert immer mehr, warum edubreak (rel. homogenes Instruktionsdesign) in unterschiedlichen Kontexten und unterschiedlichen Institutionen günstige Lernbedingungen erzeugt, mich interessiert die „dahinterliegende Struktur, das generative Muster“. So ist es nicht verwunderlich, warum meine erste, noch stürmische Forschungsnotiz (erste Überlegungen hier und weiter ausgearbeitete Gedanken hier) den Musteransatz aufgenommen hat. „Muster“ sind frei vom disziplinären Begriffsballast, überwinden leichtfüßig Kulturgrenzen, was Chancen und Risiken (z.B. mangelnde Anschlussfähigkeit) beinhaltet. Ich bin neugierig auf das, was Peter Baumgartner in seinem angekündigten Buch über didaktische Muster sagen wird. Hier suche ich Verbindungen. Eine erste Möglichkeit gibt es hierzu auf der Salzburger Lehrertagung im Januar 2011.
zu erkennen, dass mein aktuelles Leben sehr von einer Sache geprägt, ach was rede ich, getrieben ist: edubreak. 2007 war das nur ein Name, heute sind es viele Projekte, die sich weiter ausdifferenzieren. Hier und da hatte ich es schon mal angekündigt: Mich interessiert immer mehr, warum edubreak (rel. homogenes Instruktionsdesign) in unterschiedlichen Kontexten und unterschiedlichen Institutionen günstige Lernbedingungen erzeugt, mich interessiert die „dahinterliegende Struktur, das generative Muster“. So ist es nicht verwunderlich, warum meine erste, noch stürmische Forschungsnotiz (erste Überlegungen hier und weiter ausgearbeitete Gedanken hier) den Musteransatz aufgenommen hat. „Muster“ sind frei vom disziplinären Begriffsballast, überwinden leichtfüßig Kulturgrenzen, was Chancen und Risiken (z.B. mangelnde Anschlussfähigkeit) beinhaltet. Ich bin neugierig auf das, was Peter Baumgartner in seinem angekündigten Buch über didaktische Muster sagen wird. Hier suche ich Verbindungen. Eine erste Möglichkeit gibt es hierzu auf der Salzburger Lehrertagung im Januar 2011.
Und was ist mit Te ch Pi & Mali Bu, leben die beiden noch? Na klar! Zum Jahresende konnten wir uns mit dem Lebensraum Lechtal e.V. auf ein neues Modulthema einigen: Es geht um Naturschutz und Nachhaltigkeit. Die ersten Zeichnungen sind fertig und ich bin sehr gespannt, wie das neue Modul ankommt, zumal wir hinsichtlich des Figurenstils und auch der Stimmen Veränderungen erleben werden. In jedem Fall gilt aber: Die Entwicklung der Geschichte hat wieder viel Freude gemacht und die Zusammenarbeit mit Frank Cmuchal (Zeichnungen) ist Gold wert. Vielleicht wird das im folgenden Jahr was mit der Idee: „Tech Pi – der Film“. Sponsoren gesucht! :).
ch Pi & Mali Bu, leben die beiden noch? Na klar! Zum Jahresende konnten wir uns mit dem Lebensraum Lechtal e.V. auf ein neues Modulthema einigen: Es geht um Naturschutz und Nachhaltigkeit. Die ersten Zeichnungen sind fertig und ich bin sehr gespannt, wie das neue Modul ankommt, zumal wir hinsichtlich des Figurenstils und auch der Stimmen Veränderungen erleben werden. In jedem Fall gilt aber: Die Entwicklung der Geschichte hat wieder viel Freude gemacht und die Zusammenarbeit mit Frank Cmuchal (Zeichnungen) ist Gold wert. Vielleicht wird das im folgenden Jahr was mit der Idee: „Tech Pi – der Film“. Sponsoren gesucht! :).
Am Ende will ich mich wieder bedanken, bei all den Mitstreitern: Johannes Metscher und Stefan Hörterer, den engsten Mitentwicklern, bei Ingo, dem wirtschaftlichen Mitdenker, bei Tamara und Marianne den mutigen Wissenschaftlerinnen, bei Markus Söhngen, dem „Immer-noch-Fan“ der ersten Stunde, und natürlich bei Gabi, die den ganzen Sums mitträgt. Motiviert, aber auch etwas keuchend, gehe ich ins Jahr 2011.
BALANCE: Wie denken wir uns das?
Irgendwie begleitet mich das Thema „Balance“ schon länger und zwar in recht unterschiedlichen Zusammenhängen, was mir noch gar nicht so bewusst war – bis heute.
Zu aller erst denke ich an den Kontext des Lehrens und Lernens. Da fallen mir Begriffe ein wie: „Blended Learning, hybrides Lernen, Methodenmix, Interdisziplinarität“. Offenbar fordert die komplexe und oftmals widersprüchliche Bildungs- und Forschungspraxis eine Art „Mitte“ ein, die unterschiedliche Strategien, Ansätze und Paradigmen integriert und mit Geltung der jeweiligen Bereichsautonomien ausbalanciert. Doch woher nehmen wir die Idee des Ausbalancierens? Gibt es hierzu theoretische Vorstellungen, eine Art Gleichgewichtstheorie des Lehrens und Lernens jenseits der piagetischen Äquibrillation?
Zum Zweiten denke ich an unser noch junges Netzwerk Ökonomie und Bildung e.V.. Seit Beginn der Aktivitäten im Jahr 2004 schlagen wir uns u.a. mit einer zentralen Frage herum: In welchem Verhältnis stehen Ökonomie und Bildung zueinander? In den vielen Gesprächen u.a. mit Gabi, mit meinem Bruder Peter, mit Fritz Böhle und Sandra Hofhues hantieren wir immer wieder mit Metaphern, um den großen Widerspruch, aber auch die produktiven Abhängigkeiten fassen zu können – im wahrsten Sinne des Wortes „Denk-Krücken“. Vor diesem Hintergrund habe ich heute Morgen zum Buch „Welt in Balance“ gegriffen, darin enthalten das Friulanisches Manisfest, das auf knapp vier Seiten den Hintergrund zur ökosozialen Marktwirtschaft auf den Punkt bringt. Im Buch generell, in unseren Verein im Speziellen geht es um die Frage der Ausbalancierung von Interessen, nicht im Sinne einer „Harmonie“, sondern im Sinne eines Widerspruchmanagements.
Ein dritter Bereich ist die eigene Gesundheit. Um sie zu wahren, muss man sich um sie kümmern, sie vor dem Hintergrund konkurrierender Interessen in ein Gleichgewicht bringen. Erfolgsbedürfnisse und Karrierewille, Bedürfnis nach sozialen Kontakten, Wohlbefinden und Entspannung. Wer hier das rechte Maß im Blick hat, von dem aus er die vielen Ansprüche „managt“, der kann sich glücklich schätzen. Wir reden von psychosozialer Gesundheit, um darauf hinzuweisen, dass Gesundheit ein „Integral“ aus sozialen, psychologsichen und auch körperlichen Bedürfnissen ist.
Also: drei Bereiche, in denen wir etwas ausbalancieren müssen: Lernprozesse, Governance, Gesundheit. Wie eine Steckpuppe greifen diese Bereiche ineinander, von der Mikroebene einer gesundheitlichen Kohärenz bis auf die Makroebene einer öko-sozialen Marktwirtschaft. Was jeweils von uns gefordert wird, ist eben diese Suche und konkrete Umsetzung von Balance. Aber, wie denken wir uns Balance? Als Mischung, als Integration, als Widerspruchsgelage, als Fließgleichgewicht? Welches mentale Konzept, welchen „Frame“ haben wir im Kopf: eine Wippe, ein sich drehender Kreisel, ein Agonist/Antagonist-Modell, … nochmal: Wie konzipieren wir Balance, was ist die regulative Idee? Wer ein Buch kennt, das diese Frage behandelt, dem wäre ich für einen Tipp dankbar.
writers workshop: Wissenschaftliche Fairness!
 Am gestrigen Freitag habe ich zum ersten Mal an einem writers workshop teilgenommen. Bisher war dieses Format an mir vorbeigegangen, aus der Ferne habe ich Begeisterungsstürme von Peter Baumgartner und Reinhard Bauer mitbekommen. Mit der Forschungsnotiz von Reinhard und Gabi ist es dann konkreter und greifbarer geworden. Also, gestern am Freitag saß ich mittendrin und zwar als Teilnehmer und shepherd.
Am gestrigen Freitag habe ich zum ersten Mal an einem writers workshop teilgenommen. Bisher war dieses Format an mir vorbeigegangen, aus der Ferne habe ich Begeisterungsstürme von Peter Baumgartner und Reinhard Bauer mitbekommen. Mit der Forschungsnotiz von Reinhard und Gabi ist es dann konkreter und greifbarer geworden. Also, gestern am Freitag saß ich mittendrin und zwar als Teilnehmer und shepherd.
Die Kernidee eines WW ist, dass man im Vorfeld Texte von Autoren sorgfältig liest und sich Anmerkungen macht. Am Workshoptag selber werden diese Texte besprochen und zwar (a) mit einer wertschätzenden-konstruktiven Grundhaltung und (b) ohne direkte Beteiligung des Autors. Der Autor darf etwas abgerückt vom Diskussionskreis mit abgewandtem Blick „lauschen“.
Die Veränderung des Settings um die Punkte a und b macht vieles anders. Wir sind es als „typisch Deutsche“ gewohnt, schnell über die positiven Seiten einer persönlichen Leistung hinwegzugehen, um „zur Sache zu kommen“, d.h. zu kritisieren. Uns scheint das wichtig zu sein, denn wie soll man besser werden, wenn man nicht direkt auf seine Fehler hingewiesen wird: direkt, hart … aber auch fair? Über die Bedingungen dieser (wissenschaftlichen) Fairness machen wir uns wenig Gedanken, anders eben in einem writers workshop.
Das fängt damit an, dass jeder im Raum die Texte, d.h. die GEDANKEN des Autors sorgfältig gelesen hat. Das ist die notwendige Bedingung für substanziellen Zu- oder Widerspruch. Jeder, der auf normalen Tagungen seine Folien vorstellt, bemerkt schnell: Die Zuhörer können eigentlich nur einen
oberflächlichen Blick auf die visuell aufgehübschten Folien werfen.
Von Fairness spreche ich auch, weil im Workshop die Texte der Autoren im Zentrum stehen und eben nicht lästiges Machtgetue der Besserwisser oder Verteidigungsrituale des Autors, also der ganze mikropolitische oder psychologische Overhead. Der abseits sitzende Autor ist vielmehr Zuhörer seines eigenen Films. Aus dieser sicheren Distanz fallen selbst schärfere Kritik, pardon, Verbesserungsvorschläge, noch auf fruchtbaren Boden.
Fazit: Ich habe den Eindruck, dass die Bedingungen in einem WW für den wissenschaftlichen Austausch günstig sind, hier geht es fair und respektvoll zu. Die eingestreuten Rituale (sich abwenden, klatschen etc.) wirken in der Situation nicht lächerlich, sondern deuten darauf hin, dass hier etwas sehr Wertvolles und letztlich Intimes ausgetaucht wird: Gedanken.
Am Schluss noch eine Anmerkung: Ich war in einer Doppelrolle anwesend, wie gesagt als Teilnehmer und shepherd, d.h. ich durfte im Vorfeld zum Workshop die Textentstehung von Marianne betreuen. Das hat großen Spaß gemacht, zumal jeder von so einem Gedankenaustausch profitiert. Im Diskussionskreis selber, also im Workshop, ist diese shepherd-Rolle aber eher hinderlich, warum? Weil man den Text „seines“ Autors verteidigen möchte, … wehe dem, der was Kritisches sagt. Aber genau diese Verteidigung ist nicht gewollt, da muss man entweder die Klappe halten oder gleich mit dem Autor ins Abseits gehen.
EU Workshop: Driver Instructor Education 2.0
 Immer wieder ist es fazinierend zu sehen, wie rasch die Zeit vergeht. Diese informationsarme Aussage würde mich traurig machen, wenn die Zeit nicht vollgestopft wäre mit interessanten Erfahrungen, die man ja nur IN und MIT der Zeit machen kann. Zu diesen interessanten Erfahrungen gehört unser EU-Projekt, indem Möglichkeiten und Grenzen einer mediengestützten Fahrlehrerausbildung diskutiert, ausprobiert und evaluiert werden. Am Mittwoch hatten wir unser zweites Arbeitstreffen (Vorbereitung und Durchführung mit Tamara Ranner), das wir im Medienzentrum der UniBW München abhalten konnten. Gekommen waren alle Partner (Österreich, Belgien, Deutschland, Präsident der EVA e.V.) einschließlich der neuen Vertreter des Verkehrsinstits München. Inhaltlich wurden die Erfahrungen der letzten Monate besprochen, sowie Erweiterungen wie ein Portfolioeinsatz oder mobile Anwendungen diskutiert. Nun wollen wir die letzten sechs Monate nutzen, um unser Projekt auf verschiedenen Konferenzen (online educa, learntec, red confernece etc,) sowie in Zeitschriften (Fahrschule, Verkehrssicherheit etc.) vorzustellen. Der letzte Workshop wird in Österreich bei der Fahrwelt Kern stattfinden – darauf freue ich mich allein wegen der Teststrecke ;-).
Immer wieder ist es fazinierend zu sehen, wie rasch die Zeit vergeht. Diese informationsarme Aussage würde mich traurig machen, wenn die Zeit nicht vollgestopft wäre mit interessanten Erfahrungen, die man ja nur IN und MIT der Zeit machen kann. Zu diesen interessanten Erfahrungen gehört unser EU-Projekt, indem Möglichkeiten und Grenzen einer mediengestützten Fahrlehrerausbildung diskutiert, ausprobiert und evaluiert werden. Am Mittwoch hatten wir unser zweites Arbeitstreffen (Vorbereitung und Durchführung mit Tamara Ranner), das wir im Medienzentrum der UniBW München abhalten konnten. Gekommen waren alle Partner (Österreich, Belgien, Deutschland, Präsident der EVA e.V.) einschließlich der neuen Vertreter des Verkehrsinstits München. Inhaltlich wurden die Erfahrungen der letzten Monate besprochen, sowie Erweiterungen wie ein Portfolioeinsatz oder mobile Anwendungen diskutiert. Nun wollen wir die letzten sechs Monate nutzen, um unser Projekt auf verschiedenen Konferenzen (online educa, learntec, red confernece etc,) sowie in Zeitschriften (Fahrschule, Verkehrssicherheit etc.) vorzustellen. Der letzte Workshop wird in Österreich bei der Fahrwelt Kern stattfinden – darauf freue ich mich allein wegen der Teststrecke ;-).
Sport, Fahrschule, Musik … was ein Durcheinander
 In den letzten Jahren habe ich primär versucht, Artikel in Organen der Sportwissenschaft „unter“ zu bekommen, es ging um Sport, also Sportwissenschaft. Aber es geht auch (oder gerade?) um Medien, um den sinnvollen didaktischen Einsatz im Unterricht und welche Effekte das für den Einzelnen oder für die Organisation haben kann. Der Zugang zur Sportwissenschaft war und ist nicht immer einfach, weil es in den Sportwissenschaften, genauer der Sportpädagogik, noch keinen rechten Schwerpunkt „Mediendidaktik“ gibt. Aber es tut sich was …
In den letzten Jahren habe ich primär versucht, Artikel in Organen der Sportwissenschaft „unter“ zu bekommen, es ging um Sport, also Sportwissenschaft. Aber es geht auch (oder gerade?) um Medien, um den sinnvollen didaktischen Einsatz im Unterricht und welche Effekte das für den Einzelnen oder für die Organisation haben kann. Der Zugang zur Sportwissenschaft war und ist nicht immer einfach, weil es in den Sportwissenschaften, genauer der Sportpädagogik, noch keinen rechten Schwerpunkt „Mediendidaktik“ gibt. Aber es tut sich was …
Der aktuelle Artikel „Videoannotation“ (den ich zusammen mit Gabi geschrieben habe) wird in der "Medienpädagogik" erscheinen, denn dieser spezielle Ansatz hat übergreifenden Charakter und wir argumentieren in Richtung Unterrichtskompetenz, was Lehrpersonen generell ansprechen soll. Dabei nehmen wir die Erfahrungen zur Videoreflexion aus dem Sport- und Fahrschulbereich und entwickeln den bisherigen Ansatz in Richtung visuell gestützter „Verlaufsmuster“. Das Jahrbuch Medienpädagogik (wird herausgegeben von: Schulz-Zander, R., Eickelmann, B., Moser, H., Niesyto, H. &; Grell, P. beim VS Verlag für Sozialwissenschaften) ist wohl der rechte Ort, um diese neuen und wie wir hoffen innovativen Formen der Förderung von Unterrichtskompetenz zur Diskussion zu stellen. (Preprint hier herunterladen). Zukünftig möchte ich mich dem didaktischen Zusammenspiel aus übergreifenden UND domänenspezifischen Anforderungen intensiver zuwenden, … d.h. zu dem bisherigen Durcheinander von "Bewegungsfeldern" eine strukturierende Klammer finden.
