 Am 19./20.06. war das ganze SALTO-Team in der Sportschule Oberhaching (bei München) zusammen, um sich über den Stand des DOSB-Projekts auszutauschen. SALTO? Ja, das ist ein Kunstname (kein Akronym) und steht für das Ziel, Qualifizierungsprozesse im organisierten (gemeinwohlorientierten) Sport durch und mit digitalen Medien zu verbessern. Es wäre daher falsch zu sagen: Es geht um „e-Learning“.
Am 19./20.06. war das ganze SALTO-Team in der Sportschule Oberhaching (bei München) zusammen, um sich über den Stand des DOSB-Projekts auszutauschen. SALTO? Ja, das ist ein Kunstname (kein Akronym) und steht für das Ziel, Qualifizierungsprozesse im organisierten (gemeinwohlorientierten) Sport durch und mit digitalen Medien zu verbessern. Es wäre daher falsch zu sagen: Es geht um „e-Learning“.
Vielmehr handelt es sich um ein ganzes Bündel von Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen, angefangen von der Entwicklung und Erprobung geeigneter Blended Learning-Formate (Deutscher Tischtennis Bund) über die Produktion speziellen Contents (Deutscher Turner Bund), der Findung geeigneter Implementationsstrategien (Landessportbund NRW), dem Aufbau einer peer-to-peer Berufs-Community (Institut für angewandte Trainingswissenschaft) und der Entwicklung von Evaluationsmaßnahmen (Universität). All diese „Teilergebnisse“ werden am Ende technisch in ein Bildungsportal münden: ein Bildungsportal des deutschen Sports bzw. des Deutschen Olympischen Sportbundes, in dem die Bildungsverantwortlichen, aber auch Trainer/innen aller 60 Fachverbände und Landessportbünde Anregungen und Austauschmöglichkeiten einschließlich eines Lizenzmanagements vorfinden werden.
Das klingt alles ziemlich „techno-LOGISCH“ oder? Ja, wie immer ist die Gefahr groß, auf die Technik, auf Strategien, auf Checklisten oder Verfahren, auf MACHBARES zu schauen, da „hat man was in der Hand“, das man sich und anderen als Nachweis der eigenen Leistung zeigen kann. Aber man ahnt schon, dass das alles nicht genug ist, dass sogar das Wichtigste fehlt, etwas Flüchtiges, was sich nicht so leicht in Kästchen und Tabellen bringen lässt: Maßnahmen zum Kultur-WANDEL. Angestrebt wird eine neue Praxis des Lehrens und Lernens mit digitalen Medien, in der Eigenaktivität, Partizipation, Konstruktion sowie ein standortübergreifender Austausch von Information und Wissen, kurz eine neue Systemqualität, im Zentrum steht. Darum geht es am Ende, das ist die angestrebte (soziale) Innovation im organisierten Sport, von der man zwar gerne spricht, die sich aber auch gerne der Umsetzung verweigert.
Und genau das wurde auf unserer Tagung neben den vielen guten Beiträgen aus den Teilprojekten deutlich, dass es nicht reicht, wenn wir „nur“ unsere Hausaufgaben machen. Vielmehr gilt es AUCH, Kulturarbeit zu betreiben, d.h. den eigenen Wandel mit allen Versuchen, Irrungen, Hoffnungen und Erfolgen zum Thema „digitale Medien“ zum Thema zu machen, nur so verändern wir uns, nur so stiften wir andere glaubwürdig zum Mitmachen an. Konkret wird das jetzt (als erster Schritt) in einem SALTO-Blog umgesetzt, also einem Sprachrohr, einem Marktplatz, einem Versuchsraum, in dem die Beteiligten ihre Geschichten und Geschichten zu Geschichten einbringen können und sich damit erstmals einer interessierten Öffentlichkeit mit-TEILEN. Das Intelligente ist also nicht der technische Blog, klar, sondern die Artikulation von selbstbezüglichen Aktionen und Gedanken. Kulturarbeit (zum Lehren und Lernen) beginnt im eigenen Kopf. Nie war so viel Anfang wie jetzt.

 Vor kurzem hatte ich mein letztes
Vor kurzem hatte ich mein letztes  Am Freitag war ich als Referent auf den
Am Freitag war ich als Referent auf den 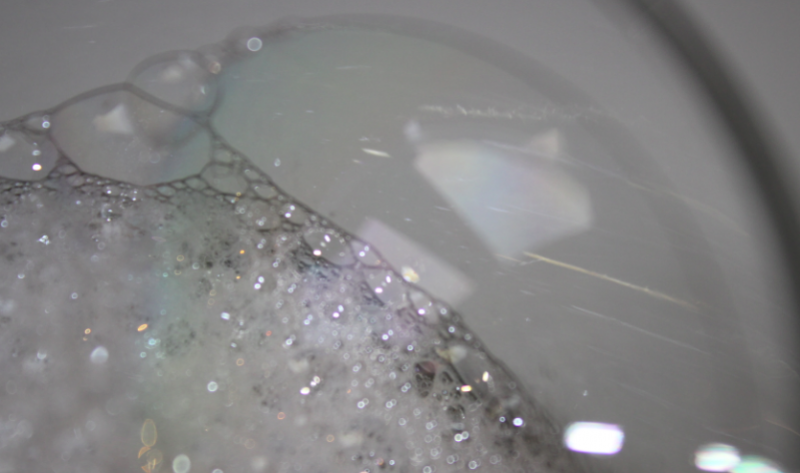 Ich bin ein moderner Mann, soll heißen, ich beteilige mich am Haushalt, reinige im Wechseln Bad, Flur und Keller, kaufe ein und stelle den
Ich bin ein moderner Mann, soll heißen, ich beteilige mich am Haushalt, reinige im Wechseln Bad, Flur und Keller, kaufe ein und stelle den  Die Zukunft Personal, Europas größte Fachmesse für Personalmanagement, ist vorbei und die Ghostthinker sind nach einer anstrengenden Woche wieder daheim im Süden Deutschlands. Doch schauen wir uns die Woche kurz an:
Die Zukunft Personal, Europas größte Fachmesse für Personalmanagement, ist vorbei und die Ghostthinker sind nach einer anstrengenden Woche wieder daheim im Süden Deutschlands. Doch schauen wir uns die Woche kurz an: Zur Zeit lese ich das Buch „
Zur Zeit lese ich das Buch „ Am Dienstag war ich im schönen Bonn, um bei der BEKO-Basketball Liga (
Am Dienstag war ich im schönen Bonn, um bei der BEKO-Basketball Liga ( Am 19./20.06. war das ganze
Am 19./20.06. war das ganze