Gerade komme ich vom serven … dass ist ja ein eigentümlicher Prozess: man weiß nicht mehr so recht wo man gestartet ist und wie man von einer Seite zur anderen gekommen ist, egal. Am Ende meiner Tour war ich beim angekündigten BMBF Programm ""Web 2.0" und unter dem Eintrag von Jochen Robes fand ich einne lesenswerten Kommentar von Helge Staedtler.
(…) "Eine Förderung der Ingenieure, um soziales Verstehen und Hineindenken in normale Menschen zu etablieren, würde sich hier eventuell als Förderprojekt anbieten. Die wahren Goldschätze sind meiner Ansicht nach aber an der Grenzen zwischen Technik und Sozialpsychologie zu finden."
Dieses Statement finde ich sehr interessant, zumal aus dem Mund eines "Technikers" (die Zuordnungen verschwimmen ehe). Helge sieht die zentrale Herausforderung im Bereich e-learning /web 2.0 im "sozialen Verstehen". Damit meint er einerseits die Kompetenz von Technologen sich in Motive von Nutzern oder potentiellen Nutzern hineinzudenken. Andererseits geht es ihm im mehr Forschung im Bereich zum Nutzerverhaltens, um die Frage "warum" zeigt man Web 2.0 Verhalten (bloggen taggen etc.). Mit einer reinen Funktionszuschreibung (Kommunikation, Selbstdatstellung, etc.) ist es wohl nicht getan. Warum nutzen einige (wenige) Menschen diese Möglichkeiten, andere aber wieder nicht?
Also, warum "mitmachen"? …das Web 2.0 wird ja u.a. auch als Mitmachnetz beschrieben. Wer will den mitmachen?? Wir haben so einen normativen Anspruch auch in Schule und Hochschule. Neulich kam ich mit Basti Grünwald (der eine tolle MA Arbeit über interaktive Erlebniswelten geschrieben hat) darüber ins Gespräch und zwar im Kontext Erlebniswelten/Erlebnisparks. Da sieht es ganz klar so aus, dass europäische Versionen sehr passiv gestaltet sind, also fahrgeschäftsorientiert. Im Gegensatz zu amerikanischen oder japanischen Erlebniswelten, da geht es richtig zur Sache, hier machen die Menschen (mehr) mit. Deshalb haben auch narrative Ansätze dort eine größere Bedeutung (interactive story telling).
Also: ist es letztlich eine Frage der Kultur? Ja sicher, wenn man voraussetzt, dass der Mensch von Natur aus neugierig ist, nach Selbstwirksamkeit strebt, sozial eingebunden und autonom sein möchte (Deci & Ryan). Mir erscheinen diese Erklärungem alle richtig, aber auch zu unspezifisch. Es ist eine Frage der Kultur, sicher, aber es geht hier doch um ein Gemengelage aus Faktoren/Begrenzungen: keine Zeit, Reflexions- und Dokumentationsleistung ist anstrengend, wenig institutionelle Anerkennung, Geringschätzung des eigenen (lokalen) Wissens vor allgemeinen Wissen, geringe Vernetzung von Beruf und Privatleben, etc. Wir wachsen in dieser Welt auf, unsere Schul- und Hochschulsysteme pauken uns diese "Logik" ein, im Beruf ist lernen zwar "angesagt", aber wenn es um "Lern-Zeit" geht, wenn es um Öffnung nach außen geht, dann geht nix mehr. Ich habe in letzter Zeit zwei Kontexte kennen gelernt, in denen das Thema Web 2.0 neu ist. Das Problem sind nicht einzelne Anwendungen, sondern die mit dem Thema Web 2.0 einhergehende "Öffnung der Organisation" und die gesehenen Gefahr eines Kontrollverlustes. Den Mehrwert eines organsiationalen!!! Kontrollverlustes (auf individueller Ebene kann das Spaß machen – siehe Grünwald 2007) müsste man noch aufzeigen.
Ja, "soziales Verstehen" ist wichtig: einmal auf der Produktionsseite von Technologen, Pädagogen, Psychologen und vor allem Domänenexperten! (interdisziplinäres arbeiten) und auf der Nutzerseite in Richtung soziale Prozesse und Motivlagen. Wer Web 2.0 aber auch für Organsiationen nutzbar machen will, der darf die Stolpersteine zum organsiationale Verstehen nicht vergessen.
 Im Kontext der von Ulrich Fahrner offiziell angebotenen Seminarreihe „Videoarbeit“ konnte ich im Semester 06/07 das Teilprojekt „Gesundheit“ anbieten (Seminarweblog). In einem eher projektorientierten Unterrichtssetting haben wir in einer kleinen Gruppe von 4 Studenten (Multimedia, MuKler) das Thema „Asthma bei Kindern“ fokussiert. Im Zentrum stand die Aufgabe, ein Präventions- bzw. Instruktionsvideo für Kinder zu drehen, indem Ursachen von, aber auch Interventionsmöglichkeiten gegen Asthma enthalten sind. Neu und herausfordert war, dass das Video „aus der Perspektive des Kindes“ entwickelt werden sollte, um möglichst große Akzeptanz- und Behaltenseffekte (evtl. auch Verhaltenseffekte) bei der Zielgruppe zu erzielen. Überraschend ist ja, dass viele Videos im Asthmabereich die Kinder ansprechen wollen, dabei aber recht häufig „Experten“ – also Erwachsene – zu Worte kommen. Uns war bewußt, dass ein „Kindervideo“ immer ein Spagat ist zwischen den Ansprüchen dieser Experten (richtige medizinische Informationen) und der Kinder, die primär Ansprachen für ihre diffusen Ängste (plötzlich Atemnot, Todesangst, nicht mehr spielen dürfen, Krank-Sein etc.) brauchen.
Im Kontext der von Ulrich Fahrner offiziell angebotenen Seminarreihe „Videoarbeit“ konnte ich im Semester 06/07 das Teilprojekt „Gesundheit“ anbieten (Seminarweblog). In einem eher projektorientierten Unterrichtssetting haben wir in einer kleinen Gruppe von 4 Studenten (Multimedia, MuKler) das Thema „Asthma bei Kindern“ fokussiert. Im Zentrum stand die Aufgabe, ein Präventions- bzw. Instruktionsvideo für Kinder zu drehen, indem Ursachen von, aber auch Interventionsmöglichkeiten gegen Asthma enthalten sind. Neu und herausfordert war, dass das Video „aus der Perspektive des Kindes“ entwickelt werden sollte, um möglichst große Akzeptanz- und Behaltenseffekte (evtl. auch Verhaltenseffekte) bei der Zielgruppe zu erzielen. Überraschend ist ja, dass viele Videos im Asthmabereich die Kinder ansprechen wollen, dabei aber recht häufig „Experten“ – also Erwachsene – zu Worte kommen. Uns war bewußt, dass ein „Kindervideo“ immer ein Spagat ist zwischen den Ansprüchen dieser Experten (richtige medizinische Informationen) und der Kinder, die primär Ansprachen für ihre diffusen Ängste (plötzlich Atemnot, Todesangst, nicht mehr spielen dürfen, Krank-Sein etc.) brauchen. 
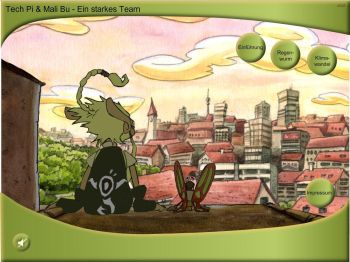
 Letzte Woche hat sich unsere EU Paedimed-Projektgruppe in Herrsching am Ammersee getroffen, um den Projektstand und die Fortführung zu besprechen. Meine anfängliche Skepsis gegenüber einer „interdisziplinären Zusammenarbeit“ vor einem Jahr ist einer pragmatischen Haltung gewichen. Diese kennzeichnet sich dadurch, dass man versucht, die unterschiedlichen Potentiale aus Medizin und Pädagogik so zu bündeln, dass ein Produkt entsteht, welches im Anwendungskontext einen Nutzen spendet. Genau diese Produktorientierung hatte ich – wenn ich mich recht erinnere – schon vor einem Jahr als „Weg“ beschrieben, wie Wissenschaftler mit unterschiedlichen Hintergrund fruchtbar zusammenarbeiten können, weil über das Produkt und die Anforderungen im Anwendungskontext (hier weht der Wind her) viele Grundsatzfragen im Hintergrund bleiben. Ich bin zuversichtlich: vielleicht ergibt sich mit einem Folgeantrag die Chance, noch deutlicher den sicherlich voraussetzungsreichen Kerngedanken der Salutogenese zu profilieren und durch eine technologisch-konzeptionelle Erweiterung mehr Partizipation seitens der Schüler und Gesundheitsteams zu ermöglichen.
Letzte Woche hat sich unsere EU Paedimed-Projektgruppe in Herrsching am Ammersee getroffen, um den Projektstand und die Fortführung zu besprechen. Meine anfängliche Skepsis gegenüber einer „interdisziplinären Zusammenarbeit“ vor einem Jahr ist einer pragmatischen Haltung gewichen. Diese kennzeichnet sich dadurch, dass man versucht, die unterschiedlichen Potentiale aus Medizin und Pädagogik so zu bündeln, dass ein Produkt entsteht, welches im Anwendungskontext einen Nutzen spendet. Genau diese Produktorientierung hatte ich – wenn ich mich recht erinnere – schon vor einem Jahr als „Weg“ beschrieben, wie Wissenschaftler mit unterschiedlichen Hintergrund fruchtbar zusammenarbeiten können, weil über das Produkt und die Anforderungen im Anwendungskontext (hier weht der Wind her) viele Grundsatzfragen im Hintergrund bleiben. Ich bin zuversichtlich: vielleicht ergibt sich mit einem Folgeantrag die Chance, noch deutlicher den sicherlich voraussetzungsreichen Kerngedanken der Salutogenese zu profilieren und durch eine technologisch-konzeptionelle Erweiterung mehr Partizipation seitens der Schüler und Gesundheitsteams zu ermöglichen.  Gestern wurde ich in die neue BMW Welt bestellt, um eine erste Führung im
Gestern wurde ich in die neue BMW Welt bestellt, um eine erste Führung im  Gestern habe ich im Rahmen der Tagung „
Gestern habe ich im Rahmen der Tagung „ Von Mittwoch bis Freitag waren Gabi und ich in Hamburg auf der diesjährigen GMW Tagung. Startpunkt war der Mittwoch und da ist mir die „schwere“ Rede von Rolf Schulmeister in Erinnerung. Man muss verstehen: Schulmeister hat sich 40 Jahre für eine verwegene Idee mit Namen Bildung krummgelegt, mit aufrechten und stolzen Gang versteht sich. Ich kann nicht verschweigen, dass mir die Tränen in die Augen kamen, als Schulmeister am Ende seiner kurze Bildungsskizze bei Sisyphus ankam, an der tiefen Einsicht (oder Aporie?), dass Bildung keinen absoluten Maßstab kennt, kennen darf, sondern jeder dazu verdammt ist, diesen Letztgrund in sich selbst zu errichten (der Fels) – selten kommt Macht und Ohnmacht der Bildung so auf den Punkt. „Verwegen“ sind all diese Gedanken deshalb, weil die moderne Universität das Glück eines Sisyphusdaseins gar nicht mehr kennen will. Schulmeister nennt seine Thesen dann auch konsequent „Unzeitgemäße“ – Nietzsche hätte seine wahre Freude gehabt … oder hätten sie gar zusammen geweint? Nun gut, … solche Momente wie am Mittwoch Abend bleiben im Kopf … und im Herzen.
Von Mittwoch bis Freitag waren Gabi und ich in Hamburg auf der diesjährigen GMW Tagung. Startpunkt war der Mittwoch und da ist mir die „schwere“ Rede von Rolf Schulmeister in Erinnerung. Man muss verstehen: Schulmeister hat sich 40 Jahre für eine verwegene Idee mit Namen Bildung krummgelegt, mit aufrechten und stolzen Gang versteht sich. Ich kann nicht verschweigen, dass mir die Tränen in die Augen kamen, als Schulmeister am Ende seiner kurze Bildungsskizze bei Sisyphus ankam, an der tiefen Einsicht (oder Aporie?), dass Bildung keinen absoluten Maßstab kennt, kennen darf, sondern jeder dazu verdammt ist, diesen Letztgrund in sich selbst zu errichten (der Fels) – selten kommt Macht und Ohnmacht der Bildung so auf den Punkt. „Verwegen“ sind all diese Gedanken deshalb, weil die moderne Universität das Glück eines Sisyphusdaseins gar nicht mehr kennen will. Schulmeister nennt seine Thesen dann auch konsequent „Unzeitgemäße“ – Nietzsche hätte seine wahre Freude gehabt … oder hätten sie gar zusammen geweint? Nun gut, … solche Momente wie am Mittwoch Abend bleiben im Kopf … und im Herzen.  Gestern habe ich mit
Gestern habe ich mit