Luhmann und die Kamerakinder

Wie ich überhaupt darauf kommen? Vor 30 Jahren (meine Jugend) gab es eine Sendung von Michael Schanze, die hieß 1, 2 oder 3. U.a. durfte da immer ein Kind HINTER der Kamera stehen, eben das Kamerakind. Angezeigt wurde das mit einem roten Rahmen und blinkenden Record-Punkt im Videobild. Das Kind musste also entscheiden, was wichtig war, was mit der Kamera eingefangen werden sollte, darin lag der ganze Spaß. Luhmann ist nun nicht bei den Was-Fragen stehen geblieben, sondern hat noch ein paar Schüppen drauf gelegt, OK. Aber die Grundidee, die hat er von den Kamerakindern, bestimmt!
Rigor ist keine Stadt

Entsprechend unbefriedigend ist es, wenn man nach 20 min (völlig richtig von der Moderatorin) seine Erläuterung abbrechen muss, denn viele Fragen bleiben offen – die Darstellung würde einen Workshop füllen. In den Ohren von Pädagogen hat die Beschäftigung mit DBR zudem etwas Mechanisches, Formalistisches, man könnte denken, „Ingenieure sind am Werk“: Man optimiert Prozesse, Organisationsstrukturen, Aufbau und Funktion von Lernwerkzeugen etc. Wo ist die pädagogische Sache, wo geht es um Lernqualitäten? Und was noch viel verwickelter ist: Man mag den Mehrwert für die Praxis noch nachvollziehen können, so wie man nachvollziehen kann, dass ein Maßanzug, der x-mal umgenäht und angepasst wurde, besser sitzt. Aber: Den Mehrwert für die Theorie, für die Erkenntnis, für die Wissenschaft erkennt man nicht, will oder kann man nicht erkennen. Wo wird hier verallgemeinert? Nach welchen verbindlichen Standards geschieht das? Es scheint tief in die DNA der wissenschaftlichen Meme eingebrannt zu sein: Es muss Rigor sein! Die dahinter liegenden Metaphern sind und bleiben bis auf weiteres bestehen: „hart“ und „weich“ (vgl. interessantes Diskussionspapier Rigor & Relevanz von Alexander Dilger), siehe auch Gabi in einem früheren Beitrag. So ist es zu verstehen, dass dieser Dualismus nun auch wieder beim DBR zur Anwendung kommt: Man unterteilt in eine eher innovationsorientierte (Gabi wurde im AK dieser Richtung zugeordnet) und eine theorieorientierte Schule. Hier geht es um Nutzen, dort um Erkenntnis. Mein abschließendes Plädoyer im AK ging in die Richtung, an diesem Punkt wachsam zu sein, denn der spezifische Beitrag des DBR besteht meiner Meinung genau darin, DURCH (!!!) Design Nutzen und Erkenntnis zu VERBINDEN, also zwei Seiten einer Medaille durch systematische und zyklische Kopplung komplexer Interventionen mit einer ebenso komplexen Praxis. Man muss gerechter Weise sagen: Verallgemeinerung in Form von Gestaltungsmustern oder (lokal begrenzten) Prototheorien, … so löst sich die Rigor-Paradoxie auf.
Vor diesem insgesamt eher skeptischen Hintergrund bin ich froh, dass ich nach unserem Arbeitskreis einen Kollegen aus der Schweiz kennen lernen durfte, Eric Jeisy von der EGS Magglingen. Er promoviert gerade über DBR. Was er in einem kurzen Nachgespräch erzählt hat, klang sehr spannend und informiert. Vielleicht ergibt sich hier noch ein intensiverer Austausch.
Dicker Rummel
Mehr als 250 Einreichungen – Glückwunsch! Iversity, Stifterverband und andere Promotoren haben die deutsche Uni-Lehre aufgeweckt. Nun haben wir es schwarz auf weiß, oder besser, in Videofarbe, wie gute Lehre funktionieren kann. Unter dem Kürzel MOOC wird seit 2011 auch in Deutschland experimentiert, erst vorsichtig bei Robes & friends, später unter anderen, d.h. flippigen, Namen bei DunkelMunkels Christian und nun diffundiert das Thema zum Volkssport, alle machen mit, an der Spitze die oben genannten Organisationen. Interessant. Ja, interessant, weil das Thema MOOCs viele Fragen im Schlepptau hat:
- Warum werden wir in Deutschland immer nervös, wenn über den Teich ein sog. Bildungs-Tsunamie zu schwappen scheint? Antworten wir mit Wettrüsten?
- Warum wirkt die große Zahl (150, 500, 2000, 160.000 Teilnehmer) auf uns so anziehend?
- Warum folgen wir (mit kleineren Varianten) dem MOOC-Script: Video, Interaktion, Test? Gibt es sinnvollere Alternativen?
- Was wird eigentlich gelernt, wenn 1000 (oder mehr) Personen „in einem virtuellen Raum sind“? Wer selektiert da, wer koordiniert da?
- Welche Vorstellung von „Wirksamkeit“ treibt uns? Skalierung?
- Wie wird die Öffnung der Hochschullehre (durch MOOCs) die Hochschuldidaktik inklusive Prüfung INNERHALB der Hochschule verändern (z.B. flipped effects, aber auch Nicht-Anerkennung von MOOC-Leistungen)?
- Welche primäre Funktion haben MOOCs: Bildungsmarketing oder High-end-Lehre oder was Drittes?
- Sind MOOCs eine soziale Innovation? In welchem Rahmen bewertet man sie angemessen?
Die Liste der Fragen ließe sich fortsetzen. Vor dem Hintergrund der kritischen Anmerkung von Gabi (Engführung der Didaktik) könnte und sollte man intensiver über didaktische Optionen, Szenarien, Ziele (Stichwort: didaktische Vielfalt) jenseits von x- oder c-MOOCs nachdenken. Parallel zu den laufenden o.g. Aktivitäten könnte man das tun, am besten im Rahmen eines MOOCs, also nachdenken über MOOCs in Form eines MOOC – ein MOOC-LOOP ;-).
care of culture

Doch darum geht es mir hier nicht! Mich ärgert kolossal, dass die Autoren die Praktiken der Free Fighter als SPORT bezeichnen. Wenn es den Fightern darum geht, den anderen möglichst stark zu verletzen, ihn niederzumachen, wenn Blut aus Augen und Ohren fließen darf (!), wenn es den Organisatoren darum geht, in sog. KampfSPORTvereinen Nachwuchs für politische und damit außersportliche (!) Zwecke zu akquirieren, dann hat das mit der kulturellen Idee des Sports NIX zu tun.
Man muss hier eine scharfe Grenze ziehen und zwar zwischen zwei SCHEINBAR gleichen Phänomen-Bereichen: auf der einen Seite die o.g. Fighter, auf der anderen Seite z.B. die Boxer. Der schnelle Blick verrät: Beide dreschen mit Fäusten auf den Gegner ein, es geht um Wettkampf, um Sieg. Aber genau diese oberflächlichen Analogien leiten in die Irre, sie sind verantwortlich dafür, dass wir alles in einen Topf werfen und damit die Grenzen zwischen roher Gewalt und kultiviertem Kampf verwischen bzw. gleich machen. Das ist, wie wenn man Porno und Liebe gleichsetzt, ein Kategorienfehler sondergleichen. Das geht nicht!
Warum rege ich mich so auf? Weil eine maßlose Inklusion (Bewegung, Spiel, Kampf … alles ist Sport) der Idee des Sports fundamental schadet, die Idee gibt Identität nach Innen und grenzt andere gesellschaftliche Phänomen-Bereiche aus. Damit wird die Idee aber auch ganz praktisch, sie ist nicht nur abgehobene Idee, sondern hilft uns, einen errungenen KULTUR-Bereich gegen andere gesellschaftliche Bewegungsphänomene abzugrenzen. Deshalb ist die Pflege der Idee, die Grenzarbeit, so wichtig.
Die Rechtsradikalen stellen ihr Treffen, die sog. Kampfsporttage, unter das Motto „Leben ist Kampf“ und genau hier ist die Zäsur: Sport grenzt sich gegenüber dem (normalen) Leben, dem Überlebenskampf ab, Sport ist ein völlig überflüssiges Ereignis, reiner Luxus, er gehört nicht zur Sphäre des Lebens, sondern zur Kunst, ein kämpferisches Spiel mit hohen ethischen Standards, bei dem die bewusste Verletzung des Gegners unter Höchststrafe – den Ausschluss – gestellt wird. GLEICHZEITIG geht es aber darum, die Spielräume der gesetzten und selbst anerkannten (!) Sportregeln maximal auszuloten. Grenzerfahrung ja, unbedingt, gar heilige Pflicht, Grenzüberschreitung niemals, auf keinen Fall, um jeden Preis zu vermeiden! Und genau in diesem höchst anstrengenden Oszillieren zwischen biologischen und ethischen Grenzen, dieser Kopfarbeit im Medium der Bewegung, liegt der genuine Beitrag des Sports an der Bildung des Menschen, das macht ihm zum KULTUR-Gut, das man gegenüber illegitimen „Kuckuckseiern“ sichern muss. Care of Culture!
Literaturtipp: Sven Güldenpfennig (2010). Die Würde des Sports ist unantastbar.
Ohne Titel

Ich muss gestehen, dass mir diese „Leseflussstörer/innen“ noch nie gefallen haben, eben aus dem Grund, dass da irgendetwas unrund läuft, wenn ich den Satz lese. Nun sagen die GralshüterInnen der genderneutralen Sprache, dass es ungemein wichtig sei, so zu verfahren, denn: Sprache sei ganz dicht mit Handeln gekoppelt; eine genderneutrale Sprache würde daher Stigmatisierungen, Asymmetrien oder andere Ungerechtigkeiten im genderbezogenen Handeln vermeiden helfen.
Aber in welcher „Umwelt“ gilt dieser Satz? Er gilt auf jeden Fall für Gesellschaften, in denen z.B. Frauen nichts zu sagen haben, sie auf der Bildfläche von Ehe, Politik, Bildung und Wirtschaft nicht oder nur im geringem Umfang auftauchen bzw. geduldet werden. DORT provoziert das kleine „innen“ oder eine Drin das Denken, erweitert (unter günstigen Umständen) den Spielraum für Frauen, da entsteht eine neue Wirklichkeit, die man unter „aufgeklärtem“ Gesichtspunkt als besser bezeichnet.
Nun ist der Ort des Geschehens aber nicht Saudi Arabien, sondern Deutschland, dort wo wir seit Jahren einen weiblichen Bundeskanzler haben, dort wo es weibliche Piloten gibt, die sogar Kampfjets fliegen, dort wo wir anfangen (offenbar ist das schwerer) darüber nachdenken, Wickelräume für Männer einzurichten. Brauchen wir in einem solchen und in dieser Hinsicht offenbar reiferen Land das putzige (als Frau ginge ich auf die Barrikaden) Drin oder andere genderneutralisierende Sprachhinweise? Kann es vielleicht sein, dass DIESE Maßnahme in DIESEM Land sogar kontraproduktiv ist?
Was wäre, wenn wir die wertvolle Energie für eine genderneutrale Sprache in Maßnahmen lenken, die sich um echte, ja echte Sprachgewalt kümmern: Dort auf den Schulhöfen und in den S-Bahnen tun sich Jungen und Mädchen mittels Sprache subtil und nackt Gewalt an und zwar in einer Art und Weise, die ich hier nicht wiederholen will. Ist das nicht der Ort, an dem wir jungen Menschen helfen müssen, sprachgewaltig und sprachmächtig zu werden, im besten Sinne des Wortes, mit qualitativ neuen Ideen von Aushandeln und Durchsetzen, jenseits von (Männer)Gewalt und (Männer)Macht?
Blended Learning für alle … mit Selbstähnlichkeit
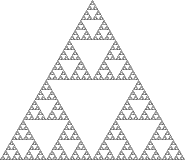
Und was gibt es KONKRET? Aktuell bereitet z.B. der Deutsche Tischtennis Bund e.V. mit seinem Teilprojekt „Blended Learning“ eine Train-The-Trainer-Tagung vor, auf der die Lehrverantwortlichen aus sechs Bundesländern in die didaktische Arbeit eingeführt werden und Vertiefungen (in edubreak) erfahren sollen. Es ist mittlerweile klar, dass wir diese Tagung methodisch im Blended Learning-Format aufbauen; virtuelle Vor- und Nacharbeit haben sich bewährt und zwar im dem Sinne, dass die PRÄSENZPHASE intensiver wird – für mich im Übrigen der Zweck von Blended Learnings, d.h. das Wert-Voll-Machen der (knappen) Präsenz.
Und nochmal, was gibt es KONKRET? Ich will nicht auf die Tagung oder das Tagungskonzept eingehen, das kommt später. Viel interessanter ist es, die „edubreak-Novizen“ aktuell in ihrer Arbeit zu begleiten – didaktisch und technisch, was eng zusammenliegt. Um den Einarbeitungsprozess der Novizen zu dokumentieren, habe ich den Beteiligten vorgeschlagen, kurze Screenvideos innerhalb des edubreak-SportCAMPUS zu erstellen, in denen sie ihre Erkenntnisse inklusive Fehltritte festhalten – also die Beobachtung des eigenen Lernens. Diese Videos „zweiter Ordnung“ haben viele Vorteile: (a) Man kann sie als geerdete Tutorials für TeilnehmerInnen verwenden; (b) sie uns Entwicklern, übersehene Klippen zu identifizieren; (c) sie helfen als kollegiales Coaching im Train-The-Trainer-Prozess; (d) sie könnten im Rahmen der Entwicklungsforschung einen Beitrag zur dichten und reflexiven Dokumentation leisten.
Mit etwas Abstand erkennt man: Immer häufiger kommt ein Prinzip zur Anwendung, das man als „Selbstähnlichkeit“ bezeichnen kann, d.h. wir erklären Blended Learning durch Blended Learning, wir unterstützen die Lernprozess der Moderatoren, indem wir die Lernprozess der Moderatoren heranziehen. Vielleicht finden sich noch weitere „Dopplungen“, die wir in den Prozess der Selbstorganisation, in ein „Blended Learning für alle“, einbringen können. Eins ist klar: Ohne dieses systemisches Salz wird die Suppe niemals fertig und schmecken würde sie auch nicht.